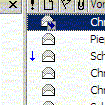Als ich so gespielt habe, hatte ich hinterher den Anstand, die Sportart zu wechseln.
Ziemlich genau diesen Satz formulierte ich ins Blaue, als am Samstag beim letzten Spieltag der Saison am Millerntor der FC St. Pauli auf ganzer Linie und komprimiert auf 90 Minuten demonstriert hat, warum sie den Aufstieg nicht geschafft haben.
Auch der kleine Alexander war mal von dem Jungs-Wunsch beseelt, ein großer Fußballspieler zu werden. Ich sah in mir den dribbelstärksten Abwehrspieler, den der Düsseldorfer Norden je gesehen hat. Was folgte, war ein Jahr Mitgliedschaft im Lohauser Sportverein, das ich im Nachhinein als eine der furchtbarsten Zeiten meines Lebens einordnen möchte.
Noch nie hatte ich so sehr das Gefühl, fremdgesteuert in einer Gruppe von zum großen Teil schwer unsympathischen Leuten hin- und hergeschubst zu werden. Vielleicht war dieses Jahr der tief verborgen liegende Grund, den Kriegsdienst zu verweigern. Das, was ich im Leben an Kompaniegeist mitnehmen musste, habe ich in diesem Jahr auf’s Feinste serviert bekommen.
Fairerweise muss ich zugeben, dass ich beim Fußball die absolute Niete war (und vermutlich auch immer noch bin). In blatanter Selbstüberschätzung versuchte ich, mein höchst unterschwelliges Talent im Rahmen der D oder E Jugend (weiß ich nicht mehr) zu schärfen. Ich ging in die fünfte Klasse und sah, dass die beiden hochgradig ballbegabten Freunde B. und O. schon seit längerem Erfolg und Anerkennung im Vereinsfußball fanden. Dorthin wollte ich auch.
Zum Probetraining an einem Mittwoch um 15:30 kam ich noch mit normalen Turnschuhen, da ich noch keine Fußballschuhe hatte. Der Jugendtrainer hat mich trotzdem mitspielen lassen. Vermutlich aus Mitleid. Die Fußballschuhe mit den unmöglich langen Schnürsenkeln, die ich mir ständig neu binden musste, machten es allerdings auch nicht besser — dafür deutlich unbequemer.
Wir waren ein geburtenstarker Jahrgang in diesem Verein. So stark, dass sehr schnell klar wurde, dass zwischen mir und einem Platz in der Mannschaft mit meinen Freunden noch ein knappes Dutzend weiterer Aspiranten stand, die sich deutlich größere Hoffnungen machten durften, zu jenen zu zählen, die nach dem obligatorischen Gruppenduschen aufgerufen wurden, sich am Samstag „zum Spiel“ einzufinden.
Der Rest des Jahrgangs wurde dominiert von einem etwas frühreifen, bereits mit einer blühenden Akne gesegneten Bully, der sehr deutlich einordnete, welchen Status man in dieser Gruppe hatte. Er war mit knapp mehr Talent gesegnet als ich, konnte sich aber auch keine Hoffnung machen, jemals Stammspieler zu werden. Stattdessen nutzte er seinen fortgeschrittenen Entwicklungsgrad (Pickel! Schamhaare!), um nach Belieben die anderen Gimpel und Balljungen zu terrorisieren.
Dem Trainergespann war das recht egal. Der Haupttrainer war hauptberuflich Getränkefahrer und genoss die 90 Minuten Training pro Woche, um zu demonstrieren, dass er anderen Leuten einiges voraus hatte; auch wenn diese anderen Menschen 20 Jahre jünger waren als er. Der Assistent war nur knapp der Pubertät entwachsen, er konnte sich auch nicht um die Harmonie im Team kümmern. Er war viel zu sehr beschäftigt damit, sich gegen den Spott meiner Mannschaftskameraden zu wehren, weil er immer die billigen No-Name Zigaretten rauchte. Soviel zu seiner Autorität.
Der Haupttrainer hatte großen Spaß darin, uns ohne ein erkennbares Konzept abwechselnd über den Platz oder über die Sandberge der nahen Autobahnbaustelle zu scheuchen. Ich kann mich nicht darin erinnern, dass uns dort mal vermittelt wurde, dass Fußball ein Sport ist, der ein gewisses Maß an Taktik erfordert. Es ging entweder um Konditionstraining oder um Trainingsspiele. Weder bei dem einen noch bei dem anderen konnte ich bestechen. Der Mitleidsfaktor des Trainers hatte sich zwischendurch abgenutzt und mitterweile war klar, dass er mich nicht zu seinen Favoriten zählte. Rein leistungsmäßig ist ihm das auch nicht zum Vorwurf zu machen.
Zum Ende der Saison war unsere Mannschaft sehr erfolgreich. Zumindest die Mannschaft, die samstags die Meisterschaftsspiele bestreiten durfte. Man hatte den Aufstieg in die sagenumwobene „Sonderliga“ geschafft. Es gab nur ein kleines Problem: Der größte Teil der Mannschaft, der den Aufstieg erspielt hatte, stieg altersbedingt auch in eine andere Jugendmannschaft auf. So blieb der ruhmreiche Platz in der Sonderliga den Jüngeren vorbehalten, die sich — wenn ich mich richtig erinnere — zum großen Teil aus eben jenen Gimpeln und Wasserträgern zusammensetzte, die mir auch sonst das Leben zur Hölle machten.
Wider Erwarten kam doch mein erster Einsatz: Gruppenduschen, Abtrocknen und dann die Worte des Trainers:
Am Samstag will ich sehen: […], Alexander, […]
Ich war der König der Welt. Nun hatte es doch etwas genützt, dass ich wochenlang auf der elektronischen Schreibmaschine meines Vaters Mannschaftsaufstellungen durchgedacht habe. Ich war dabei. Zwar nur im B-Team, aber nun konnte ich es allen beweisen.
Das Spiel am folgenden Samstag war ein heilsamer Schock: Wir spielten gegen Sparta Bilk im Süden der Stadt. Die erste Halbzeit ging noch ganz gut, doch in der zweiten Hälfte verschuldete ich zuerst einen Elfmeter und schoss danach das erste und letzte Tor meiner Laufbahn. Leider traf ich das falsche Tor. Wir verloren 1:3. Mein Stammplatz war ernsthaft gefährdet.
In der Woche drauf bekam ich eine zweite Chance. Gegen Post SV habe ich eine halbe Glanzleistung gebracht und dem Gegner den Ball abgenommen. Um die Situation zu entschärfen, spielte ich ihn ins Seitenaus. Das Gesicht des Mannschaftskameraden und die barsch gestellte Frage, warum ich denn nicht nach vorne spielen würde, werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Zur Halbzeit wurde ich ausgewechselt. Da wir zu wenig Trikots hatten, wurde ich gebeten, einem anderen Spieler das Trikot zu geben. Ich sollte ihn in der Umkleidekabine treffen. Habe weder die Umkleide gefunden, noch den Teamkameraden erkannt. Ab da galt ich bei Trainern und Betreuern als grenzdebil.
Krönung dieser Zeit war der Vereinsausflug nach Meschede im Sauerland. Mir war schon vorher schlecht. Wir sollten gegen eine Mescheder Jugendmannschaft spielen und hinterher einen zünftigen Grillabend mit anschließender Übernachtung in der Jugendherberge verbringen.
Das Freundschaftsspiel wurde so organisiert, dass in der ersten Halbzeit die Gimpel und Wasserträger spielen sollten. Es wurde die Devise ausgegeben, dass wir uns dem Gegner nicht so offen zeigen sollten, waren wir doch deutlich mehr Spieler als ein normales Auswechselkontingent verkraftet hätte. Daher wurde in der Pause einfach die ganze Mannschaft ausgetauscht. Der Plan ging nicht ganz auf, die Sauerländer sind dahinter gekommen.
Zu der Nacht in der Jugendherberge muss ich nicht viel sagen, außer dass es für den Schamhaar- und Akne-Bully ein Tag wie Ostern und Weihnachten gleichzeitig gewesen sein musste, uns auch noch nachts traktieren zu können. Mein armes Elefantenkissen. Hätte ich es doch zu Hause lassen sollen?
Nach einer Zeit, von der ich nicht mehr genau weiß, wie lange sie war, die sich aber anfühlt wie ein gutes Jahr, kam ich zum Tischtennis. Mein Vater wandte noch ein, dass es gerade für Jugendliche in meinem Alter wichtig sei, einen Mannschaftssport zu betreiben, aber es war mehr ein freundlicher Hinweis als ein Befehl. Meine Abmeldung beim LSV ging kurz und schmerzlos. Sie hatte schriftlich zu erfolgen und wurde mit einer halbherzigen Frage quittiert, warum ich denn den Verein verlassen wollte. Ich murmelte etwas von „Fußball zu anstrengend“ und war heilfroh, diesem Irrsinn entkommen zu sein.